NEUE UND WESENTLICH VERBESSERTE FASSUNG 25-03-2025
Download Audio-mp3.Datei:
https://matth2323.de/wp-content/uploads/2025/03/Der-Wahnsinn-des-Jephta-25032025.mp3
Die Familientragödie des Jephtah, der uns im Hebräerbrief als Glaubensheld vorgestellt wird, weiß man ungeachtet dieses Lobes in bibeltreuen Gemeinden wenig anzufangen. Es ist eine eher peinliche Geschichte, die erhebliche Zweifel an der Qualität des Glaubens entstehen lässt, der im Handeln Jephtahs zum Ausdruck kommen soll. Schon deshalb eignet sich dieser Bericht aus der Bronzezeit sehr gut zum Üben spirituellen Urteilsvermögens, sofern er mit Hilfe der Axiome der Liebe und der Wahrheit nach den Maßstäben Jesu neu bewertet wird.
Zum spirituell zuverlässigem Urteilen hat der Heilige Geist alle Gläubigen, die sich von ihm leiten lassen, autorisiert: “Ein Mensch dagegen, der den Geist Gottes geschenkt bekommen hat und sich von ihm leiten lässt, kann alles richtig beurteilen. Sein Urteil hält jeder Überprüfung stand.“ (1Kor 2,15) In vielen bibeltreuen Gemeinden ist diese Tatsache leider nicht bekannt. Oft erhebt sich sofort der eingeübte Zweifel: Darf und kann der Christ, der zudem noch nicht einmal Theologe ist, überhaupt derartige Urteile fällen? Obiger Vers macht uns Mut: er kann und er darf. Wir werden sehen.
Wann gibt jemand Gott ein Versprechen? Es ist bekannt, dass Menschen in einer ausweglosen schweren Notlage sich der Hilfe Gottes versichern wollen. In solchen Situationen wird man sich leicht seiner Unwürdigkeit gewusst. Man hat sich nie um Gott gekümmert, hat “Fünfe gerade sein lassen”, und bei seinem Streben auf die Mitmenschen wenig oder keine Rücksicht genommen. Warum sollte sich dann Gott für die persönlichen Nöte interessieren? In dieser Situation bitten Menschen Gott nicht nur um Hilfe, sondern verknüpfen damit zusätzlich ein Gelöbnis, etwa “ein besserer Mensch zu werden” oder fortan im Leben mehr nach dem Willen Gottes zu fragen. Manchmal wird auch eine einzelne gute Tat versprochen, um Gott zum Handeln zu bewegen. Ein sehr bekanntes Beispiel: als eines seiner Kinder schwer erkrankte, hat der Schauspieler Michael Landon Gott versprochen, im Falle der Heilung eine Serie über Gottes Werk auf Erden zu drehen. So entstand die beliebte Serie “ein Engel auf Erden”, die der Öffentlichkeit wesentliche Inhalte des christlichen Glaubens nahebringt. Wie man sieht, können Gelübde dieser Art durchaus zu wertvollen Wendepunkten oder neuen, guten Kapiteln im Leben werden.
Ein Gott gegebenes Versprechen (Gelübde) kann auch gefährlich sein. Es ähnelt einem Kreditvertrag. Gott soll das Versprochene als bereits geleistet betrachten, dass später nachgeliefert wird. Das Alten Testament warnt deutlich davor, das Versprechen zu brechen: “Es ist besser, wenn du nichts gelobst, als dass du gelobst und es nicht erfüllst. … Oder willst du, dass Gott zornig auf dein Reden wird und das Werk deiner Hände verdirbt?” (Pred 5,3)
Gerade bei jungen Menschen, die kaum etwas besitzen, was sie für Gott einsetzen können, ist es sehr gut möglich, dass sie in unüberlegter Weise Gott etwas versprechen, was sie entweder dauerhaft überfordert oder später ihr Gewissen sehr belastet. Diese Gefahr ist in einem Klima sklavisch-religiöser Überforderung eher gegeben, das dem Gläubigen sein Defizit an Hingabe in quälender Weise bewusst macht. Das ständige Gefühl, das, was verlangt wird, “nicht bezahlen zu können” kann dann den Wunsch entstehen lassen, “einen Kredit aufzunehmen”, d.h. Gott im Voraus “etwas Großes” zu versprechen. Hier kann der Wunsch nach Hingabe an Gott u.U, die Form eines destruktiv wirkenden Versprechens annehmen.
Starke religiöse Begeisterung, der Gruppendruck (man will nicht zurückstehen, wenn andere von ihren Taten für Gott berichten) oder auch schlechtes Gewissen (“Jesus opferte dein Leben für dich. Und was tust du für ihn?” oder auch “Menschen kommen in die Hölle, weil sie Jesus nicht kennen. Willst du nicht dein Bestes geben, damit mehr gerettet werden…?), all diese starken Kräfte wirken auf junge, unerfahrene Seelen ein. . ”
Wenn nun junge Menschen in einer starken, aber vorübergehenden religiösen Begeisterung versprechen, “alles dem Herrn zu weihen”, “als Missionar hinauszugehen”, oder “für das Reich Gottes ehelos zu bleiben” wie es einst Paulus war und später erkennen sie, dass sie sich eine Last aufgelegt haben, die sie gar nicht tragen können, dann stehen sie vor der Alternative, entweder ein unsinniges Gelübde einzuhalten und damit lebenslang unglücklich zu sein, oder es zu missachten und immer in Angst vor einem Gott zu leben, der alles was sie sich vornehmen, ruinieren wird. Wenn sich dann auch noch Misserfolg im Leben einstellt, dann können schwere Depressionen die Folge sein.
Man sieht wie wichtig es ist, Gläubige möglichst früh und mit Nachdruck über diese Gefahren für die seelische Gesundheit aufzuklären. Doch wie viele Glaubensgemeinschaften praktizieren das?
Als Einstieg in das Thema kann der Bericht von Jephtah sehr gut dienen, der sich auf ein Ereignis in der Zeit der “Richter” (1250 – 1000 v.Chr.) bezieht. Was geschah damals? Der damalige General Israels Jephtah musste die Israeliten zum Krieg gegen den König der Ammoniter führen. Für den Fall des Sieges versprach er Gott, “Gibst du die Ammoniter in meine Hand, so soll, was mir aus meiner Haustür entgegengeht, wenn ich von den Ammonitern heil zurückkomme, dem HERRN gehören, und ich will’s als Brandopfer darbringen.” (Ri 10,31). Seine Bitte wurde erfüllt. Die Ammoniter erlitten eine verheerende Niederlage. Doch als er nach Hause kam, “lief seine Tochter tanzend und das Tamburin schlagend heraus, ihm entgegen. Es war seine einzige; er hatte sonst kein Kind. Als er sie sah, zerriss er vor Schmerz sein Gewand und rief: “Ach, meine Tochter, du brichst mir das Herz! Dass gerade du es sein musst, die mich ins Unglück stürzt! Ich habe Gott mein Wort gegeben, und ich kann nicht zurück!” Doch sie sagte zu ihm: “Mein Vater, wenn du Gott etwas versprochen hast, dann mach mit mir, was du gelobt hast! Gott hat dir ja auch den Sieg über deine Feinde, die Ammoniter, geschenkt. Dann fügte sie hinzu: “Nur eine Bitte habe ich: Gib mir noch zwei Monate Zeit. Ich möchte mit meinen Freundinnen in die Berge gehen und meine Jungfrauschaft betrauern.” “Geh nur”, sagte ihr Vater und gab ihr zwei Monate Zeit. So ging sie mit ihren Freundinnen in die Berge und weinte darüber, nie verheiratet gewesen zu sein. Als die zwei Monate um waren, kehrte sie zu ihrem Vater zurück, und er erfüllte sein Gelübde an ihr. Sie hatte nie mit einem Mann geschlafen. Daraus entstand in Israel der Brauch, dass die jungen Frauen jedes Jahr vier Tage lang zusammen weggehen und die Tochter Jephtahs von Gilead besingen.” (Ri 10, 34 – 40 / NeÜ)
Jephtah wagte nicht, sein Gelübde zu widerrufen. Im Gesetz des Mose wird davor eindringlich gewarnt. “Wenn du deinem Gott, ein Gelübde ablegst, dann sollst du es ohne Verzögerung erfüllen. Denn Jahwe, dein Gott, wird es sonst von dir einfordern und es wird dir als Sünde angelastet. Wenn du es unterlässt, etwas zu geloben, wird dir keine Sünde angelastet.” (Deu 22,21-22) Konkret wird hier zwar keine Strafe genannt, aber ein Mensch, der sich solcherart an Gott versündigt hat, wird nicht mehr mit dem Segen Gottes rechnen können. Dies unterstreicht auch die spätere Warnung des Salomo: “Wenn du Gott ein Gelübde ablegst, erfülle es ohne Verzug! Leichtfertige Leute gefallen Gott nicht. Halte, was du versprichst! Es ist besser, wenn du nichts gelobst, als dass du gelobst und es nicht erfüllst. Gestatte deinem Mund nicht, dich in Schuld zu bringen, und sag dem Boten nicht ins Gesicht: “Es war ein Versehen!” Oder willst du, dass Gott zornig auf dein Reden wird und das Werk deiner Hände verdirbt?” (Pred 5,3)
“willst du, dass Gott … das Werk deiner Hände verdirbt ..” – ein schrecklicher Satz! Was immer der unglückliche Mensch beginnt, wird verflucht sein und scheitern! Ein lebenslanges Verfluchtsein! Und danach? Wird der Zorn Gottes wenigstens nach diesem Leben besänftigt? Oder bleibt er ewig bestehen, weil der Bruch eines Versprechens eine “mutwillige Sünde” ist (Hebr 10,26), die nicht vergeben werden kann? “Geht von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln…” (Mt 25,41)
Bis heute streiten sich die Ausleger darüber, ob Jephtah nun seine Tochter als Brandopfer opferte, sie tatsächlich tötete, oder nicht. Martin Luther schrieb: “Manche sind der festen Überzeugung, dass sie nicht geopfert wurde, doch der Text ist zu deutlich, um diese Auslegung zuzugestehen.” Nach Samuel Ridout entspricht diese Sicht auch dem, was wir über Jephtahs Charakter wissen: “Er gibt sich als ein strenger, selbstgerechter Mann zu erkennen, der später guten Gewissens 42.000 seiner israelitischen Brüder tötet. Solch ein Mann ist auch dazu in der Lage, seine eigene Tochter buchstäblich zu opfern. Er hatte das Schwert gezogen, um die Ammoniter zu schlagen; er tötete seine Tochter, weil er es gelobt hatte, und tötete seine Brüder. Freund und Feind erfahren dieselbe Behandlung.” Kurtz sieht in Sacred History Beweise für ein buchstäbliches Opfern “in der Verzweiflung des Vaters, der großmütigen Ergebenheit der Tochter, dem jährlichen Gedächtnis und der Trauer der Töchter Israels und in der Geschichte des Schreibers selbst …, der nicht dazu in der Lage ist, das schreckliche Schauspiel deutlich und klar zu beschreiben, das er gleichzeitig sowohl mit Bewunderung als auch mit Abscheu betrachtet.”
Wieviel kann der Hinweis auf das ausdrückliche Verbot von Menschenopfern im mosaischen Gesetz (Lev 20,2; Dtn 18,10) hier Klarheit beisteuern? Das steht zwar im Gesetz, doch kannte Jephtah es? Schon zu Beginn der Richterzeit ging das Wissen um das Gesetz zeitweise ganz verloren: Nach dem Tod Josuas “kam ein anderes Geschlecht auf, das den HERRN nicht kannte noch das Werk, das er an Israel getan hatte.” (Ri 2,10) Wenn man sich weder an Gott noch an den Auszug aus ägyptischer Sklaverei erinnern kann, dann an sein Gesetz erst recht nicht!
Die Befürchtung, dass jemand den Fluch Gottes auf sich zieht, der sein Versprechen nicht einhält, liegt dagegen auch ohne spezielle Kenntnis des Gesetzes nahe.
Seit dem 12ten oder 13ten Jahrhundert ist eine weniger schreckliche Version der Tragödie bekannt, die David Kimchi (1160-1235) und Levi Ben Gershon (1288-1344) vorschlagen. Sie sehen in dem “Betrauern der Jungfrauschaft” einen Hinweis darauf, dass das Opfer Jephtahs darin bestand, dass seine Tochter zu unauflösbaren, lebenslangem Dienst am Heiligtum verpflichtet wurde, was den Verzicht auf Ehe und Nachkommen zur Folge gehabt haben soll.
Die Formulierung “und ich will sie als Brandopfer darbringen” hat hier die Bedeutung des Ganzopfers, eines Opfers ohne Wenn und Aber, ohne die Möglichkeit nachträglicher Einschränkung oder Umwandlung. Mit dieser Formulierung verzichtet Jephta ausdrücklich auf die Möglichkeit der Ablösung des Gelobten durch eine Entschädigungssumme. Für Jephtah wäre angesichts der reichen Beute sicher kein Problem gewesen, eine Ablösungssumme für das erstgeborene Kind zu zahlen. (Ex 34,19-20). Diese Auslegung geht also davon aus, dass Jephta das mosaische Gesetz gut kannte. Zum zweiten geht sie davon aus, dass Jephtah bei seinem Gelübde schon das Risiko sah, dass es ziemlich wahrscheinlich war, dass ihm seine Tochter entgegenlaufen würde. In diesem Fall würde er durch sie keine Nachkommen haben und andere Töchter oder Söhne hatte er nicht, mit denen er eine Dynastie hätte aufbauen können. Die Ehrfurcht vor Gott hinderte ihn, Gott in seinen Kuhhandel, im Ausgleich für den Sieg Oberhaupt des Volkes zu werden, einzuspannen und eine fürstliche Belohnung für etwas in Empfang zu nehmen was einzig und allein der Gnade Gottes zu verdanken war. Ein Sieg würde ihm den Chefposten bringen, aber die Entscheidung über die Möglichkeit einer Dynastie wollte er Gott überlassen.
Seine Tochter, die seine Entscheidung akzeptiert und unterstützt, zeigt damit eine Seelengröße, die der Jephtas durchaus gleichkommt.
Natürlich ergeben sich einige Schwierigkeiten bei dieser Sichtweise. Die Frage bleibt, ob nicht ein besseres Gelübde möglich gewesen wäre, ohne die ahnungslose Tochter so fürchterlich zu belasten. Hätte er nicht auch ohne das Opfer seiner Tochter auf Gründung einer Dynastie verzichten können? Der Sohn oder Enkel eines Kriegshelden erbt nicht automatisch dessen Führungseigenschaften und Charakter. Das Buch Richter zeigt ja, dass Gott sich einzelne Richter erwählte und sie beglaubigte. In solchen Zeiten macht doch das Träumen von einer selbst gegründeten Dynastie nicht allzu viel Sinn. Warum dann der unselige Entschluss, dass eigene Familienglück aufs Spiel zu setzen? Warum diese fatale Konzentration auf sich selbst und eine mögliche Karriere? Gibt es wirklich keine besseren Optionen, die er mit mehr Weitblick hätte erkennen können?
Wäre es nicht angebracht gewesen, ein großes, selbstloses Dankopfers zugunsten der Ärmsten seines Volkes zu geben? Damit hätte er ebenfalls deutlich deutlich gemacht, dass Gott allein der Sieg zu verdanken war und vielleicht wäre durch dieses Signal sogar der erbarmungslose Krieg mit den neidischen Ephraimiten vermieden worden, der noch weiteren 42.000 Menschen das Leben kostete. Hätte er nicht als Chef die Chance gehabt, sich in vorbildlicher Weise um die Ärmsten des Volkes zu kümmern? Er hätte versprechen können, alle Sklaven durch Hingabe seiner Kriegsbeute auszulösen. Wieviel Menschen hätten ihn bewundert, geliebt und gepriesen! Er hätte der größte Sozialreformer der Bronzezeit werden können und sein Ruhm hätte die Jahrhunderte überdauert! So mancher Herrscher wäre überdies motiviert gewesen, seinem leuchtenden Vorbild zu folgen! Wem fiele es dann noch schwer, die göttliche Inspiration zu erkennen! Solche Versprechen hätten höchstes Niveau gehabt und wären ganz im Sinne Gottes gewesen.
Es ist ein überwiegend trostloser Eindruck, den diese Geschichte hinterlässt. Dieser Eindruck hatte eben auch etliche Ausleger zu dem Schluss kommen lasen, Jephta hätte tatsächlich seine Tochter getötet. Andere Richter, die befürchteten, ihrer Aufgabe nicht gewachsen zu sein, wurden durch Engel oder Propheten ermutigt. Doch Jephta hat keinen “Draht nach oben”. Seine Angst, zu versagen, musste er durch ein Gelübde kompensieren.
Was mich übrigens auch sehr erstaunt: dass in allen späteren Büchern der Bibel überhaupt keine erhellende Anmerkung zu diesem Bibeltext auftaucht. Allenfalls der – von Luther sehr kritisch bewertete – Hebräerbrief bezeichnet Jephtah als Glaubensheld (Hebr 11, 32). Doch inwiefern hilft uns sein Vorbild, stärkeres Gottvertrauen oder Ehrfurcht gegenüber Gott zu bilden? Das Resultat: Jephta ist entsetzt, ja verzweifelt. Die Tochter weint monatelang. Auch Gott weiß – wie es scheint – keinen Ausweg. Von ihm bleibt ein übler Eindruck zurück, der Eindruck eines gnadenlosen Pedanten, dem sterile Prinzipien viel wichtiger sind als der Gedanke, verirrte, in ihrer Dummheit gefangene Menschen zu trösten und wieder zurück auf einen heilsamen Weg zu führen. Wenigstens im Lichte des Evangeliums müsste das doch irgendwie klar werden! Aber auch im Hebräerbrief fällt kein inspirierendes Licht auf die trostlose Geschichte! Was hat eine Geschichte vom unerbittlichen Zwang des Gewissens im Neuen Bund zu suchen, in dem es heißt: “zur Freiheit hat uns Christus befreit. Achtet drauf, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst!” (Gal 5,1)? Was hat diese Geschichte im Neuen Bund zu suchen? Wie kommt der Verfasser des Hebräerbriefes nur auf die Idee, dass diese unselige Geschichte ohne jeden Kommentar (!) der gläubigen Gemeinde als positives Beispiel vorzustellen sei!
Die Lösung ist ganz einfach! Wenn man die Geschichte mit dem “Schlüssel Jesu” aufschließt, dh wenn man den Qualitätsmaßstab Jesu “Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Verlässlichkeit” (Mt 23 23) auch hier anlegt, kommt man zu einer Beurteilung, die glaubwürdig ist. Die Geschichte Jephtahs ist ein wunderbarer und unwiderleglicher Beweis, dass man die Bibel anders gar nicht auslegen kann und darf! Aufschlussreich ist auch, wie WENIG Ausleger in der Theologiegeschichte die innere Freiheit hatten, diesen Maßstab kompromisslos auf die trostlose Geschichte anzuwenden! Deswegen ist Jephtah in der Gemeinde weitgehend unbekannt . Jephtah war ein Niemand und er blieb ein Niemand. Seine Geschichte deprimiert und wird gern vergessen. Die Reaktion frommer Ausleger zeigt uns, wie viele von ihnen trotz vollmundiger Erlösungspropaganda unterschwellig ein eher deprimierendes, ja zum Teil bösartiges Gottesbild dulden.
Auch im Neuen Testament kommen Gelübde vor. Für Paulus waren Gelübde ein Weg, Vertrauen bei seinen jüdischen Glaubensgenossen zu bilden. (Apg 18,18) Wir brauchen nicht zu zweifeln, dass diese Gelübde in Freiheit und Liebe geschahen und Segen bringen konnten.
Etwas anders verhält es sich mit der Ermahnung des Paulus in Bezug auf Ehelosigkeitsgelübde junger Frauen: “Jüngere Witwen aber weise ab; denn wenn sie sich wegen ihres Begehrens von Christus abwenden, so wollen sie heiraten. Sie stehen dann unter dem Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben.” (1.Tim 5,11) So lautet die Übersetzung Luthers. Aus ihr kann man eigentlich nur schließen, dass der Bruch eines Ehelosigkeitsversprechens für einen Christen gleichbedeutend ist mit dem Abfall von Christus und mit Festhalten an Sünde und Treulosigkeit. Der Abfall von Christus wird nicht vergeben – das Schicksal solcher Menschen wäre unausweichlich die ewige Verdammnis.
Hier hätten wir eine ähnliche Situation wie bei Jephtah, denn Paulus betont ausdrücklich, dass er solche Versprechen für unvernünftig und unzumutbar hält. Müsste sich jetzt jemand aufgrund seiner Dummheit lebenslang zu quälender Ehelosigkeit zwingen, um im Himmel anzukommen, so hätten wir hier ganz klar den Beweis vor uns, dass das Tun doch erheblich zur Erlösung beiträgt und dass es Gott vor allem völlig gleichgültig ist, ob das Tun mit dem Motiv der Liebe oder dem der Angst geschieht.
Der Wortsinn ergibt also keinen Sinn. Deswegen ist die wortwörtliche Übersetzung dahingehend zu ergänzen, dass der Verdienstgedanke sicher ausgeschlossen ist. Gut gelungen ist das zum Beispiel in der Neuen Evangelistischen Übersetzung: “Nimm keine jüngeren Witwen in das Verzeichnis auf. Denn das Verlangen nach einem Mann kann bei ihnen dazu führen, die Verpflichtung zu vergessen, die sie Christus gegenüber eingegangen sind, als sie sich ins Verzeichnis aufnehmen ließen. Dann wollen sie wieder heiraten und ziehen sich den Vorwurf zu, ihrem vorher gegebenen Versprechen untreu geworden zu sein.” (1.Tim 5,11-12)
Hier geht es also nur um den üblen Eindruck, den ein Bruch des Versprechens bei Menschen hinterlässt. Die Beziehung zu Gott ist nicht gefährdet.
Ebenso wie bei der Frage der christlichen Schiedsgerichtsbarkeit und der Frage, ob Frauen in der Gemeinde reden dürfen, haben wir es hier wieder mit der gelegentlich unklaren Ausdrucksweise des Apostels zu tun.
Unüberlegte Versprechen, die nicht gehalten werden können, können zu lebenslanger Belastung des Gewissens und zur Befürchtung führen, unter Gottes Fluch zu stehen. Wem ist damit gedient? Der Ehre Gottes?
Leider hängen nicht wenige Bibellehrer sklavisch am Wortlaut. (Gift Nr 13) Oder sie reagieren auf die Jephtah-Geschichte mit betretenem Schweigen. Einfach nicht daran denken? Ist ein Bibellehrer hier Bibellesern keine klare Auskunft schuldig? Gibt es keine, obwohl Paulus betonte (2.Tim 3,16), dass “alle von Gott inspirierte Schrift nützlich ist zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit?” Worin besteht der Nutzen der Jephtah-Geschichte ? Muss man sich dann wundern, wenn manche der von ihnen belehrten Gläubigen große Mühe haben, sich von werkgerechter Depression zu lösen?
[Andere Beispiele von “no-comment”-Texten]

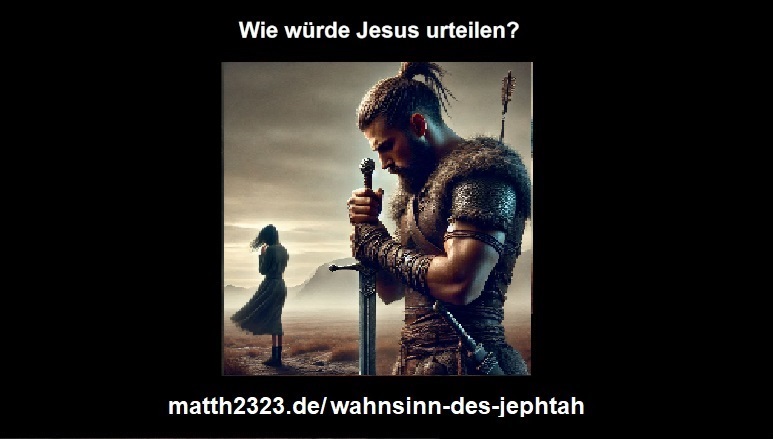
hallo, ich habe mal dort nachgeschaut unter (Lev 3, 5 – 6) aber da steht nicht das, was du geschrieben hast. Sei nicht böse, aber von wo hast du diese Übersetzung? Oder hast du aus Versehen eine andere Bibelstelle genannt?
Lieber Anonymous,
es freut mich sehr, wenn Leser sorgfältig lesen und mich auf Fehler aufmerksam machen. Die Bibelstelle Lev 3,5 ist tatsächlich ein Versehen. Den zitierten Text findest du bei 3Mo 5,4 ff. Vielen Dank nochmal für den Hinweis.